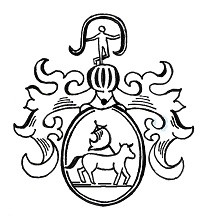Virgin Mary
Ab und zu existieren Orte im Leben, die unvergesslich sind. Sie halten das Herz gefangen, lassen Bilder tanzen und die Seele beben.
Rouven Benjamin zog den Kragen seines Mantels fest zusammen. Regen prasselte auf die Erde. Tropfen liefen über sein Gesicht den Hals hinunter. Die Feuchtigkeit sickerte unaufhaltsam durch.
Rouvens Blick schweifte zu dem nahe gelegenen Hügel, der über die Stadt wachte. Die Häuser am Hang standen, dicht gedrängt, mit flachen Dächern, ohne Fenster, wie grellweiße Grabsteine, leblos den Naturgewalten ausgesetzt. Dieser Platzregen dauerte an. Der Himmel weinte. Er war zurück in ihrer Welt, in Casablanca. Jener Stadt, in der sie starb.
Lange hatte er überlegt und mit sich gerungen, ob der Aufwand es wert wäre. Die Ausgrabungen in Südamerika kosteten. Sie boten Geld, zuviel um nein zu sagen und das Leben musste weiter gehen. Trotzdem war ihm nicht wohl bei seiner Entscheidung. Diese Stadt hielt Erinnerungen gefangen, erstickte jede Zukunft.
»Verzeih mir«, murmelte eine innere Stimme.
Er stand auf dem „Boulevard des Almohades“, nahe der Kreuzung zur „rue de Zenata“. Die Ampeln blinkten. Ein Blitz musste die Elektrik beschädigt haben. Er kämpfte gegen den Wind an und machte, instinktiv, Schritte in Richtung Hafen. Benjamin blieb stehen und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Die Besprechung in der französischen Botschaft zwei Strassen weiter duldete keinen Aufschub. Der Wind schubste ihn vorwärts. Er ließ sich treiben und stapfte los. Eine unsichtbare Hand schien ihn zu führen, streichelte seine Seele, linderte den Schmerz. Vielleicht war alles auch nur der vertrauten Gegend geschuldet und das an einem Montag. Seine Weigerung, ein Taxi zu nehmen, verfluchte er in diesem Moment.
Die Docks wirkten gottverlassen, kein Mensch in Sicht. Bei den Schiffen heulte eine Sirene. Der Wind ergriff den Ton und trieb ihn aufs Meer hinaus. Rinnsale aus Wasser durchfurchten den Marktplatz. Das Meer rollte wütend über den Strand. Gischt spritzte über die Kaimauern. Die Lichter der Frachtschiffe im Hafen schaukelten ohne Unterlass und beleuchteten den Schaum auf den Wogen.
Einen Augenblick lang verschnaufte das Toben um ihn herum. Benjamin rümpfte die Nase. Der Geruch von Fleisch in Knoblauch eingelegt, zog in seine Nase. Er steuerte in die Bar „petit trou“. Eine Wolke aus Wein und sanitären Einrichtungen empfing ihn. José stand hinter der Theke, wer sonst. Die Bar verdiente den Namen „das kleine Loch“. Ihre Inneneinrichtung ähnelte einer schwarzweiß Filmausstattung der Vierziger des letzten Jahrhunderts. Eine ideale Kulisse für die filmische Neuauflage eines „film noir“.
»Salut mec.« Über Benjamins Gesicht glitt ein Lächeln. José schaute hoch. Seine vergilbten Zähne strahlten ein Willkommen.
»Ça va mon grand.«
Er wischte seine Hände an der Schürze ab und streckte sie ihm entgegen.
»Schön, dass du wieder in der Gegend bist. Warst lange nicht hier.«
José zauberte Gläser auf dem Tresen und goss ein. Benjamin prostete ihm zu. Der Selbstgebrannte duldete keine Schwäche. Die Vergangenheit lächelte ihn an. José streckte ihm die Zunge heraus. Sie war blau. Offensichtlich gedieh der Kräutergarten hinter dem Wohnhaus nach wie vor prächtig. Rouven Benjamin lachte und tat es ihm gleich. Es mutete wie früher an, aber er wusste, Ewigkeiten beschützen nur verhurte Wahrheiten.
»Das Geschäft geht?«
José zuckte mit den Achseln.
»Die Saison ist vorbei.«
Benjamin nickte. Während des Sommers blühte der Handel. Jetzt, im Herbst, begann die gefährliche Zeit für die kleineren Boote auf dem Atlantik und brachte den Schmuggel zum erliegen. Das Geschäft erledigten nun die Hochseetauglichen.
Benjamin schaute in den Raum. Maria, Josés zweite Schwester, summte eine Melodie, während sie ein Hemd flickte und auf die Kochtöpfe auf dem Herd aufpasste. Er winkte, sie lachte zurück. Zu ihren Füßen hockte ein Kind im Schneidersitz und lutschte an einem Korken. Zwei Matrosen spielten Karten. In der Ecke neben der Tür saß ein junges Mädchen. Sie löffelte eine Suppe, ausgerechnet an dem besonderen Tisch.
Benjamins Blick suchte die Seitenkante. Er sah die aufgeplatzte Maserung. Ja, das war er. An diesem Tisch entdeckten sie ihre Liebe füreinander, packten Geschenke aus und einmal tanzte sie auf der Tischoberfläche. Jetzt saß dort, in gerader Haltung, vielleicht ein wenig zu vornehm für diese Örtlichkeit, ein junges Mädchen und speiste. Sie tat es wie Antonia, drei Finger ausgestreckt, Ellbogen leicht angewinkelt und den Kopf stolz erhoben. Die Ähnlichkeit raubte ihm den Atem.
»Wer ist das?«
»Nie gesehen. Die ist fremd.« José griff einen Lappen und wischte auf der Theke herum. Den Kopf hielt er gesenkt. Benjamin musterte ihn.
»Bist du nervös?«
»Dieses Mädchen … «
»Was ist mit ihr?«
»Ihre Augen haben den bösen Blick.«
Rouven grinste.
»Sicher, sie entspringt direkt der Hölle.«
»Durchaus möglich«, raunte José ihm zu. »Die ist besessen, ich sehe das.«
»Du bist und bleibst ein Voodoo Spinner«, schüttelte Rouven den Kopf. »Ich finde sie hübsch.«
Das Mädchen strahlte Verletzlichkeit aus und zu seinem Erstaunen trug sie keine Schminke. Ihre Haut war dermaßen blass, dass die Haare umso dunkler schienen. Außerdem verlieh diese spitze Nase ihrem Gesichtsausdruck etwas Nobles.
Zeitweise nippte sie an ihrem Glas Wasser und irrte mit den Augen umher. Ihr Blick traf ihn. Das junge Mädchen lächelte nicht, er auch nicht. Trotzdem gab es ein Lächeln, tief im Verborgenen, einer stummen Vereinbarung gleich. Einer der Matrosen sprach sie an, bot ihr einen Drink an, sie verweigerte. Sie nippte wieder an dem Glas und wehrte auch ein erneutes Angebot des anderen dankend ab. Benjamin beobachtete sie. Ihre Augen faszinierten ihn. Das kristallklare Blau strahlte Ehrlichkeit aus. Böses entdeckte er nicht.
Der erneute Seitenblick von ihr war das Signal. Er ging zu ihr. Seine Neugier überwog. Sie lächelte und überraschte ihn mit einem freundlichen „guten Tag, setzen sie sich“. Ihre Aussprache, in seiner Muttersprache, ohne jeden Akzent, überraschte ihn.
»Danke«, antwortete er und nahm Platz.
»Ich habe auf sie gewartet«, begann sie und löffelte weiter ihre Suppe.
Rouven stutzte.
»Wie bitte?«
»Mein Name ist Mary. Sie haben mich gerufen, schon vergessen?«
»Ich wüsste nicht, dass …«
»Meinen Bruder, den Alp, kennen sie gut. Er kommt häufig zu ihnen, nicht wahr?«
»Wer sind sie?«, stieß Rouven hervor. Das Mädchen ließ den Löffel zwischen ihren Lippen durchgleiten. Sie betrachtete ihn, wie man einen fremden aber interessanten Gegenstand in Augenschein nimmt.
»Er hat mir oft erzählt, dass sie um Vergeltung bitten.«
»Wie bitte?«
Die Situation erschien ihm surreal. Rouven fühlte Entsetzen seinen Nacken empor kriechen. Meine Träume gehören mir, schrie es in ihm. Ja, ich forderte Gerechtigkeit. Das Leben könne grausam sein, haben alle gesagt. Vielleicht wollte ich auch Rache, aber das war anfänglich, unter Schock. Auf einen Schlag standen die Ereignisse wieder vor seinen Augen. Der Unfall, ihr qualvoller Tod im Krankenhaus, das Gefühl der Ohnmacht und diese elende Hilflosigkeit.
»Ich will nicht«, stammelte Rouven Benjamin und fühlte den Sog in längst Verdrängtes. Das junge Mädchen lächelte.
»Man nennt mich „Virgin Mary“«, sagte sie und legte den Löffel in die Nähe des Tellers. Mit einer Serviette tupfte sie behutsam den Mund ab.
»Wahrscheinlich weil ich noch so jung bin.«
»Ach ja?«
Ihre blauen Augen strahlten.
»Sie sind mein dritter Kunde hier in der Umgebung.«
»Für was?«
»Ich muss viel lernen«, nickte sie ihm aufmunternd zu. »Nicht jeder der meine Hilfe sucht, bekommt sie auch. Schließlich ist der Preis hoch.«
Rouven war sprachlos.
»Ich …«, stotterte er. Sie winkte amüsiert ab.
»Meine Wahl ist auf sie gefallen. Freut sie das?«
Ihr freundlicher Augenausdruck zog ihn herunter, in meerblaue Untiefen.
»Bevor sie mir ihren Plan erzählen, sagen sie mir bitte, wird es blutig?« Sie legte ihren Kopf leicht zur Seite.
»Wäre schön, ich habe schon lange solche Phantasien.«
Rouven schwieg und starrte dieses Wesen vor ihm ungläubig an. Aus Verlegenheit spielten seine Finger an der zerbröckelnden Tischecke herum. Er befühlte die alte Vertiefung, in der wieder ein Kaugummi klebte. Dieses Mädchen konnte entweder geheimste Gedanken lesen oder war eine Meisterin im Erraten von Zusammenhängen. Er schüttelte den Kopf. Unheimlich. Nervös drückten seine Finger an einem abstehenden Holzstück herum.
Das junge Mädchen ließ den Löffel spielerisch zwischen den Fingern hin und her gleiten.
»Sie wissen doch, Träume können wahr werden. Ich will ihnen helfen, wirklich.«
Rouven hatte genug gehört und es drängte ihn zurück an die Theke. Die Nähe zu diesem Mädchen bereitete ihm Unbehagen. Sie ist verrückt, schoss es ihm durch den Kopf. Besser ich gehe jetzt.
Er versuchte aufzustehen. Die Beine verweigerten den Dienst. Erst jetzt bemerkte er, dass in seiner Umgebung eine merkwürdige Ruhe herrschte. Kein Laut drang zu ihm durch. Sein Kopf zuckte herum. Die Menschen in der Bar verharrten in atemlosen Stillstand. Plötzliche Angstgefühle vernebelten sein Denken.
»Gut so«, munterte ihn das Mädchen auf. »Sie schaffen eine ausgezeichnete Grundlage.«
Rouven erhöhte mit dem Finger den Druck auf den Holzsplitter. Er brach ab und fiel auf den Boden. Rouven betrachtete seine Hand. Ein kleiner Blutstropfen perlte an der Hautoberfläche. Sie reichte ihm ein besticktes Taschentuch. Ihr Gesichtsausdruck drückte Zufriedenheit aus.
»Furcht ist ein prima Nährboden für spontanes Handeln.«
Das Mädchen stand auf und stellte ihren Stuhl zurück vor den Tisch. Sie öffnete ihre Handtasche und holte einen Zettel heraus.
»Hätte ich glatt vergessen. Ich brauche ihr Einverständnis.«
Rouven Benjamin nahm das Stück Papier aus ihrer Hand.
»Hier steht kein Wort.«
Das Mädchen lachte.
»Endlich mal ein amüsanter Auftraggeber.«
Sie deutete mit dem Zeigefinger auf die untere Seitenhälfte.
»Unterschreiben sie unten rechts.«
»Wozu?«
»Jeder Wunsch braucht die Zustimmung des Trauminhabers.«
Wie von Geisterhand geführt, huschte seine Hand über das Papier. Rouven Benjamin unterschrieb. Das junge Mädchen dankte höflich und nickte ihm zu.
»Wir sehen uns.« Ihr Augenaufschlag versprach aufregende Zeiten. »Ich freue mich auf unsere gemeinsame Nacht.«
Die Eingangstür klappte auf, kalte Nachtluft strömte herein, sie verschwand. In diesem Moment spürte Rouven kräftige Hände an seiner Schulter.
»Mon Grand, wach auf«, schrie José. »Was hast du getan?«
Rouven schaute hoch und rieb über die Augen. Der Schleier verschwand, die Umgebung erstrahlte in hellen Farben. Sonne schien durch das Fenster neben der Eingangstür.
»Ich habe mich unterhalten, sonst nichts.«
»Mit wem? Schau dich mal an«, schnaufte José. »An deiner Hand klebt Blut.«
Erschrocken drehte Rouven seine Hände in alle Richtungen. Er fand eine Verletzung an der rechten Hand, eine kleine Schnittwunde.
»Nichts Schlimmes«, wiegelte er ab und bemerkte verschmierte Blutstropfen auf der Tischfläche.
»Hab mir die Haut aufgerissen, wahrscheinlich an dieser verdammten Kante. Was ist mit dem Mädchen?«
»Welches Mädchen?« José war außer sich. »Seit drei Tagen sitzt du hier am Tisch und faselst davon, nicht schlafen zu dürfen.«
Er hielt ihm die Zeitung vor sein Gesicht.
»Hier schau. Dieser Besoffene der unsere Antonia totgefahren hat, ist bestraft worden.«
Mit dem Zeigefinger tippte Jose auf die Schlagzeile der Vorderseite.
»Die Polizei spricht allerdings von einem bestialischen Mord.«
Rouven registrierte die Mittwochausgabe der Tageszeitung und schnellte hoch. José schauderte.
»Man hat dem Kerl angeblich bei lebendigem Leib den Brustkorb aufgeschnitten und sein Herz geklaut. Ist das nicht grauenhaft?«
Rouven Benjamin riss ihm die Zeitung aus der Hand.
»Die Azteken sind bekannt für solche Rituale. Nur die Priester durften …«
»Sie schreiben, du hättest es herausgelöffelt.«
»Hast du nicht gerade gesagt, ich säße seit drei Tagen an unserem Tisch?«
José umarmte ihn.
»Sie werden uns nicht glauben.«
»Warum?«
»In dem Kopf des Opfers steckte ein Holzsplitter.«
»Na und?«
»Daran hing ein Zettel mit deiner Unterschrift.«